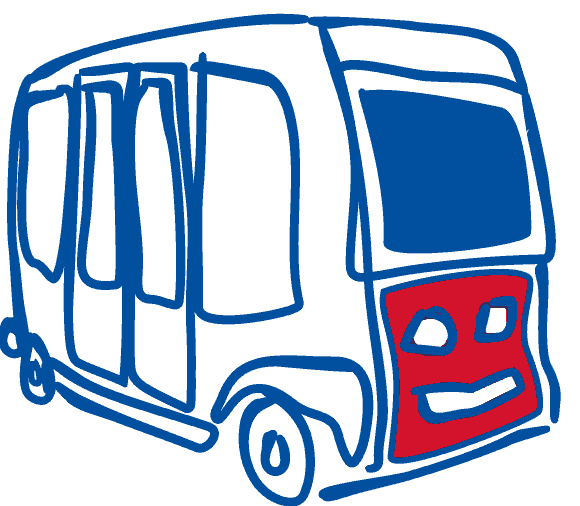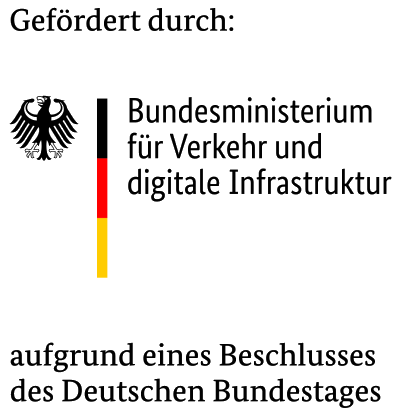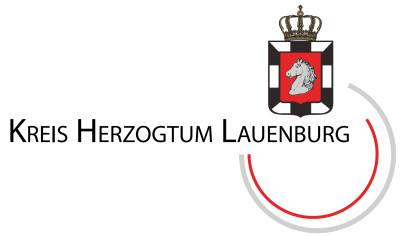Allgemeine Fragen zum Projekt:
1. Was bedeuten die Begriffe 'TaBuLa', 'TaBuLa-LOG' bzw. 'TaBuLa-LOGplus'?
TaBuLa ist die Abkürzung für „Testzentrum für autonome Busse im Kreis Herzogtum Lauenburg“. Damit wird umschrieben, dass in einer Testumgebung im Kreis Herzogtum Lauenburg Tests für den Einsatz von automatisierten bzw. autonomen Bussen durchgeführt wurden. Der Zusatz "LOG" steht für die Integration einer Logistik-Komponente in Form eines Transportroboters. Das „plus“ kennzeichnet die dritte Phase des Projektes, in der die Vernetzung und Koordinierung der verschiedenen Vehikel durch eine zentrale Leitstelle geschaffen werden soll.
2. Was waren die Projektziele?
Im Projekt TaBuLa wurden Möglichkeiten und Hindernisse des Einsatzes automatisierter und vernetzter Fahrzeuge im Nahverkehr untersucht. Darüber hinaus erfolgte die Entwicklung eines Testfelds für automatisierte Busverkehre unter echten Verkehrsbedingungen.
Mit TaBuLa-LOGplus soll der Automatisierungsgrad der eingesetzten Fahrzeuge (Vehikel) erhöht, der Einsatz optimiert und die Überwachung durch eine Leitstelle realisiert werden.
3. Wer waren die Projektpartner*innen und Unterstützer*innen?
Alle Infos zum Projektteam sind hier zu finden.
4. Was ist der Unterschied zwischen dem autonomen und dem automatisierten Fahren?
Es gibt sechs verschiedene Level der Automatisierung, die beschreiben, welche Aufgaben das Fahrzeug übernehmen kann. Beim (hoch-)automatisierten Fahren (Level 3) übernimmt das Fahrzeug nur für ausgewählte Situationen die Steuerung und die Fahrtüberwachung. Beim vollautomatisierten (Level 4) oder autonomen Fahren (Level 5) übernimmt das Fahrzeug die gesamte Steuerung und die Fahrtüberwachung in allen Situationen. Der*Die Fahrende wird zum*zur Passagier*in.
5. Was kostet(e) das Projekt?
Das Projektvolumen von TaBuLa betrug 2,25 Mio. Euro, davon wurden 1,92 Mio. Euro durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) getragen.
Das Projektvolumen von TaBuLa-LOG belief sich auf 1,99 Mio. Euro, davon wurden 1,79 Mio. Euro durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) getragen.
Das Projektvolumen von TaBuLa-LOGplus beläuft sich auf 1,99 Mio. Euro, davon wurden 1,84 Mio. Euro durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) getragen.
6. Wie lange läuft das Projekt TaBuLa-LOGplus?
Die offizielle Projektlaufzeit endet am 31.12.2024.
Fragen zum TaBuLa-Shuttle:
1. Ist der Bus barrierefrei?
Die im TaBuLa und TaBuLa-LOG-Projekt eingesetzten Busse waren barrierefrei. Sie hatten keine Stufen im Fahrzeuginneren und besaßen eine ausfahrbare Rampe (belastbar bis 350 kg). Zudem wurden im Laufe des Projektes mehrere Haltestellen möglichst so eingerichtet, dass ein nahezu niveaugleiches Einsteigen sichergestellt werden konnte.
2. Wie schnell ist der Bus gefahren?
Die Bus-Shuttle in Lauenburg fuhren für das Projekt TaBuLa-LOG mit max. 18 km/h.
3. Wie wurde für die Sicherheit im Straßenverkehr gesorgt?
Alle derzeit erhältlichen automatisierten Fahrzeuge verfügen über Kameras und Lidar-Sensoren. Lidar steht für „Light detection and ranging“. Das Lidar-System ist eine Art Scanner. Das Erkennen von Hindernissen in einem vorgegebenen Gefahrenbereich ist somit garantiert. Zudem fahren die Fahrzeuge passiv und reagieren bei jeder potenziellen Gefahrensituation sehr vorsichtig. Im Fahrzeug selber befindet sich immer ein Fahrzeugbegleiter, der die Funktion eines Fahrzeugführers übernimmt.
4. Wer war Betreiber des Kleinbusses?
Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH waren während des Projektzeitraumes Betreiber der automatisierten Kleinbusse (Shuttle).
Fragen zum Fahrbetrieb:
1. Wie sind die Fahrzeiten / Wann fährt der Bus / Woher weiß ich wann der Bus kommt?
Der Betrieb endete leider am 30.11.2021.
2. Kostete die Mitfahrt Geld? / Was kostete eine Fahrkarte?
Da es sich um einen Testbetrieb gehandelt hat und das Projekt gefördert wurde, war die Mitfahrt für alle Fahrgäste kostenlos.
3. Bremst der Bus bei Hindernissen?/ Weicht der Bus Hindernissen aus?
Bei plötzlich auftretenden Hindernissen bremst das Fahrzeug automatisch. Im Laufe des Projektes konnte stets nur ausgewichen werden, wenn die Begleitperson das Fahrzeug manuell bediente.
4. Wird der Fahrbetrieb der Shuttles im Rahmen von TaBuLa-LOGplus wieder aufgenommen?
Der Weiterbetrieb der Shuttles hing von der Förderung in einem weiteren Förderprojekt außerhalb von TaBuLa-LOGplus ab. Leider konnten keine Mittel für den Weiterbetrieb akquiriert werden. Aus diesem Grund wird der Betrieb der automatisierten Shuttles nicht fortgesetzt. Zur Demonstration eines praktischen Szenarios werden im Projekt TaBuLa-LOGplus manuell gesteuerte Busse verwendet. Der Testbetrieb mit diesen Bussen und dem automatisierten Transportroboter ist in der zweiten Jahreshälfte 2024 vorgesehen.
Fragen zu rechtlichen Rahmenbedingungen und dem Einsatz von automatisierten Fahrzeugen:
1. Wo dürfen automatisierte Fahrzeuge derzeit fahren?
Nach derzeitiger Rechtslage dürfen hochautomatisiert oder autonom fahrende Fahrzeuge ohne Begleiter*in nur auf Privatgelände fahren, da dort die Straßenverkehrsordnung nicht gilt. Darüber hinaus ist ein Einsatz dort möglich, wo die Straßenverkehrsbehörden den Einsatz solcher Fahrzeuge über eine Ausnahmegenehmigung regeln, wie in unserem Projekt. Mit der heutigen Gesetzeslage ist ein Einsatz auf öffentlichen Straßen grundsätzlich nur möglich, wenn eine Begleitperson (Operator/Steward) das Fahrzeug jederzeit übernehmen kann.
2. Wo fahren automatisierte Fahrzeuge schon?
Hochautomatisierte Kleinbusse werden in mehreren Dutzend Testfeldern in Europa, Asien, Australien und Amerika eingesetzt. Einige Beispiele können Sie der Innovationslandkarte "Autonomes Fahren im ÖPNV" entnehmen.
3. Auf welchen rechtlichen Grundlagen basiert die Genehmigung von automatisierten Bussen?
Fahrzeugeinsatz: Für den Einsatz von automatisierten Bussen mit Fahrgästen im öffentlichen Straßenraum muss eine Zulassungserfordernis nach den Anforderungen aus Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Straßenverkehrsordnung (StVO) und Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) erfolgen, weil es sich um Kraftfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h handelt.
Personenbeförderung: Hinzu kommen die Anforderungen aus dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG), das die entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung von Personen regelt.
4. Wer erteilte die Genehmigungen für den Einsatz des Busses in Lauenburg/Elbe?
Fahrzeugeinsatz: Die erforderliche Einzelbetriebserlaubnis gemäß §21 StVZO wird von der zuständigen Genehmigungsbehörde erteilt, welche die nach Landesrecht zuständige Stelle am Ort des Unternehmenssitzes bzw. der beteiligten Niederlassung des Halters vom Fahrzeug ist. Vorzulegen ist dafür ein Gutachten einer Technischen Prüfstelle (z. B. TÜV Nord Mobilität), die zum einen die technischen Vorschriften und zum anderen davon abweichende Ausnahmen gem. §70 StVZO und §47 FZV am konkreten Fahrzeug prüft.
Voraussetzung für die Genehmigung ist außerdem der ausschließliche Betrieb auf der im Verfahren konkret angegeben Strecke. Im Rahmen des Verfahrens werden neben der genehmigenden Behörde u. a. betroffene Straßenbaulastträger, Kreise und Stadt beteiligt.
Personenbeförderung: Für die Genehmigung des Linienverkehrs (eine zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten eingerichtete regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der Fahrgäste an bestimmten Haltestellen ein- und aussteigen können) ist nach Personenbeförderungsgesetz (PBefG) die zuständige Genehmigungsbehörde für den Ort der Leistungserbringung zuständig. Konkret werden die Anträge hierfür vom Kreis Herzogtum Lauenburg in Ratzeburg und dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Kiel bearbeitet.
5. Stellte der Bus eine Konkurrenz des öffentlichen Nahverkehrs oder eine Ergänzung dar?
Der Testbetrieb stellte keine Konkurrenz für das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in Lauenburg/Elbe dar.
Die Erwartung allgemein ist, dass die bisher verfügbaren Minibusse die Aufgaben der Feinerschließung und der letzten Meile übernehmen werden und somit eine Ergänzung bzw. sogar eine Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Nahverkehrs darstellen können.
6. Welche Auswirkungen haben Projekte wie TaBuLa auf das Berufsbild des Busfahrers?
TaBuLa war eines von mehreren Förderprojekten mit automatisierten Minibussen. Diese Projekte finden in Testanwendungen statt, wo heute meist keine öffentlichen Verkehre angeboten werden. Sie ersetzen also keine heute vorhandenen Verkehre.
Mittelfristig können die Minibusse gerade dort Verkehrsaufgaben übernehmen, wo der konventionelle Bus aufgrund seines Antriebes, seiner Größe oder einer unwirtschaftlichen Platzierung an seine Grenzen stößt. Auswirkungen auf das Berufsbild des Busfahrers sind jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten.
Fragen zu Laura, dem Transportroboter:
1. Wofür steht "Laura"?
Laura steht für "Lauenburgs Automatisierte Roboter Auslieferung".
2. Wie groß ist Laura?
Laura ist ca. 51cm lang, 43cm breit sowie 62 cm hoch und hat ein Gewicht von ca. 50 kg.
3. Wie schnell ist Laura gefahren?
Laura fährt maximal 6 km/h, also in etwa Schrittgeschwindigkeit.
4. Wurde Laura immer von einer Aufsichtsperson begleitet?
Ja, Laura wurde (und wird weiterhin) über die gesamte Laufzeit der Projekte immer von einer Aufsichtsperson, einem „Buddy“, begleitet.
5. Welche Daten benötigt Laura von der Umgebung?
Die wichtigsten Informationen für Laura sind die, die ihr erlauben festzustellen, wo sie sich gerade befindet. Dafür werden unterschiedliche 3D Sensoren (Stereo-Kameras, Laserscanner) verwendet.
6. Inwieweit musste die Infrastruktur angepasst werden? (benötigt der Bus z. B. Signale von der Ampel?)
Für den Betrieb von Laura mussten keine technischen Änderungen an der Infrastruktur in Lauenburg vorgenommen werden. Sie hat aber das Podest, das einen barrierefreien Einstieg an der Shuttle-Haltestelle am Kirchplatz erlaubt, benutzt.
Fragen zum Einsatz von Laura in Lauenburg:
1. Wie viele Transportroboter hat es in Lauenburg gegeben?
Während des Projektes TaBuLa-LOG ist nur ein Roboter in Lauenburg gefahren. Es gibt aber noch einen zweiten in der Werkstatt des Instituts für Technische Logistik der TU Hamburg, an dem die Entwicklungsarbeit parallel zum Betrieb in Lauenburg fortgesetzt wurde. In TaBuLa-LOGplus gibt es keinen Regelbetrieb der Roboter.
2. Konnte über TaBuLa-LOG auch der Einkauf nach Hause oder eigene Waren transportiert werden?
Nein, Laura war ausschließlich für die Post der Lauenburger Verwaltung zuständig.
3. Wird Laura nach der Testphase auch woanders eingesetzt?
Es wird natürlich nach weiteren Einsatzgebieten für Laura gesucht, bisher gibt es dahingehend aber noch keine konkreten Pläne.
Fragen zu Laura und dem Shuttle:
1. Wie viele Personen konnten im Shuttle und können im Linienbus mitfahren, wenn Laura mitgefahren ist?
Corona-bedingt konnten in letzter Zeit maximal 3 Personen mitfahren. Im Projekt TaBuLa-LOGplus wird Laura, aus entwicklungstechnischen Gründen, nicht im regulären Fahrgastbetrieb mitfahren. Das Ziel für die Zukunft ist, dass weiterhin die reguläre Fahrgastanzahl in Linienbussen befördert werden kann und Laura (bzw. Transportroboter im Allgemeinen) im Mehrzweckbereich des Busses platziert wird.
2. Wie sicher war der Transport von Laura im Shuttle?
Das Thema Sicherheit ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Entwicklung von Laura und die Fahrt im Shuttle oder im Linienbus spielt da natürlich auch eine große Rolle. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, wurde in der Entwicklungsphase in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord eine Risikoanalyse und ein Sicherheitskonzept erstellt und anschließend vom TÜV geprüft. Beispielsweise ist im Fall einer Notfallbremsung der Transportroboter gesichert, sodass der Schutz der Mitfahrenden zu jeder Zeit gewährleistet ist.